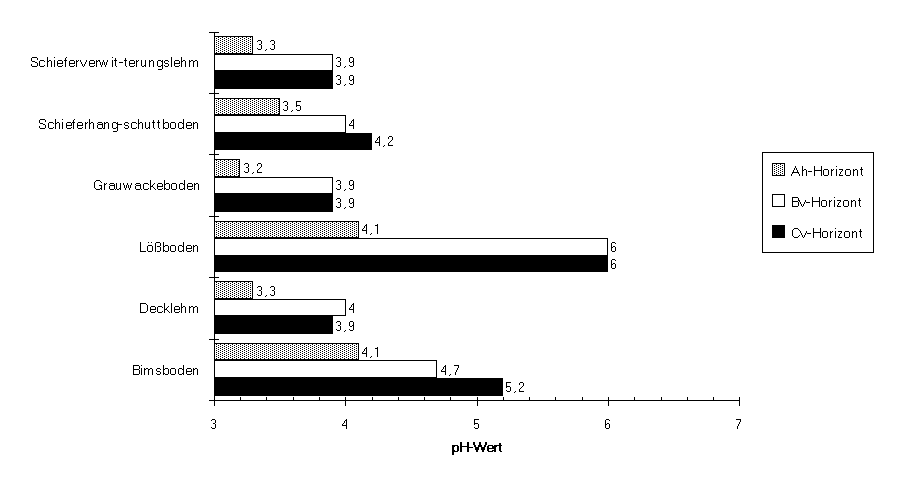
Stoffliche Bodenbelastung
Stoffliche Bodenbelastungen gehen aus von schadstoffbefrachteter Luft, von Abwasser, Straßenverkehr und Freizeitaktivitäten, von Bioziden, Düngemitteln, Klärschlamm und Gülle, von Deponien und Altlasten sowie durch unsachgemäßen Umgang oder Unfälle mit Chemikalien oder anderen bodengefährdenden Stoffen.
In Abhängigkeit vom Grundgestein sind Bodenbelastungen auch natürlicherweise vorhanden. Dies bezieht sich jedoch nur auf natürliche Substanzen, wie beispielsweise einen gewissen Gehalt an Schwermetallen, nicht jedoch auf künstliche Substanzen, wie beispielsweise Atrazin und andere chemische Pflanzenbehandlungsmittel, FCKW (Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe) und andere Substanzen, die in der Natur nicht vorkommen.
2.1 Auswirkungen stofflicher Bodenbelastung
Der Eintrag von Schadstoffen führt langfristig zu Veränderungen der Bodeneigenschaften durch Bindung, Einbau oder Austausch der eingetragenen Stoffe an Bodenteilchen oder durch Ausfällen von Stoffen auf chemischem Wege. Störung der Bodenlebewesen, Verminderung der Bodenfruchtbarkeit, Verminderung der Regenerationsfähigkeit und die Gefahr einer irreversiblen Bodenschädigung sind die Folge. Alle Substanzen bauen sich nur in der belebten Bodenzone ab, unterhalb sind sie nahezu unbegrenzt haltbar!
Über Beeinträchtigung des Grundwassers und der Aufnahme von Schadstoffen aus dem Boden in die Nahrungskette ist die menschliche Gesundheit betroffen. Besonders gefährdet sind Kleinkinder, die gerne alles in den Mund stecken. Für Kindergartengelände, Spiel- und Sportplätze sind ebenso wie für Wasserschutzgebiete, Gartenland und landwirtschaftliche Nutzflächen besondere Anforderungen an die Schadstoffreiheit des Bodens zu stellen.
2.2 Datengrundlagen
Die Erforschung des Bodens als Umweltmedium, seine Belastung und Belastbarkeit steht derzeit noch am Anfang. Grunddaten zur Beschreibung der aktuellen Bodensituation in Rheinland-Pfalz werden zur Zeit vom Geologischen Landesamt in Form eines Bodenbelastungskatasters erhoben. Erfaßt wird insbesondere die Belastung der Böden mit Schwermetallen geogenen und menschlichen Ursprungs. In einer ersten Phase wurden 10 Meßtischblätter bearbeitet, die jedoch den Kreis Neuwied nicht umfassen. Eine Bearbeitung der weiteren Meßtischblätter soll folgen.
Da das Medium Boden in engem stofflichen Austausch mit dem Medium Wasser steht, lassen sich aus Wasseranalysen Rückschlüsse auf die stoffliche Bodenbelastung ziehen. Ebenfalls im Auftrag des Geologischen Landesamt wird das "Engerser Feld" (Stadt Neuwied) zur Zeit hydro-geologisch untersucht. Veröffentlichte Daten liegen noch nicht vor. Die Daten des Bodenbelastungskatasters sowie des Projekts "Engerser Feld" sind in einer Fortschreibung des Umweltberichts zu berücksichtigen.
Detaillierte chemische Bodenanalysedaten liegen derzeit in Form einer Substratreihenanalyse für die Forstbereiche des Landkreises vor. Die Erhebungen werden von der Bezirksregierung (Forstdirektion) durchgeführt Ergebnisse sind in Abschnitt 2.4 Bodenversauerung aufgeführt.
2.3 Deposition von Luftschadstoffen
Die Mehrzahl der umweltgefährdenden Substanzen, die aus privaten Haushalten (Heizen, Autofahren) und der Industrie in die Luft abgegeben werden gelangt letztendlich in den Boden. Leichtflüchtige Schadstoffe, wie z.B. Schwefeldioxid und Stickoxide können sich über sehr große Entfernungen vom Entstehungsort hinweg ausbreiten. Mit dem Niederschlag (nasse Deposition) oder durch Ablagerung (trockene Deposition) werden sie dem Boden zugeführt. Nicht flüchtige Substanzen wie z.B. Schwermetalle werden im Schwebestaub über weite Strecken verfrachtet.
Die Depositionsraten von Luftschadstoffen sind unter Bäumen erheblich höher als im Freiland. Dies beruht auf einem "Auskämmeffekt" von Luftschadstoffen durch Nadeln und Blätter. So können beispielsweise die Depositionswerte für Schwefel und Nitrat in Waldbeständen und dabei insbesondere bei Nadelbäumen bis zu vierfach höher sein als im Freiland (Ergebnisse der 25jährigen Ökosystem- und Waldschadensforschung im Solling). Im Kreisgebiet sind hohe Depositionsraten daher vor allem in den niederschlagsreichen Waldbereichen der Höhengebiete zu verzeichnen.
Schwefeldeposition: In den achtziger Jahren waren für die Bundesrepublik Deutschland durchschnittliche Depositionsraten von 15 bis 80 kg Sulfatschwefel pro Hektar im Freiland und bis zu 150 kg pro Hektar und Jahr in Waldgebieten zu verzeichnen. Mit 24 bis 43 kg/ha wurden in Rheinland-Pfalz auch unter Fichtenbeständen vergleichsweise geringe Sulfateinträge gemessen. Daten zur Sulfatdeposition im Kreis Neuwied liegen nicht vor.
Seit etwa 10 Jahren sind die Schwefeleinträge aufgrund der Maßnahmen zur Minderung der Schwefelemissionen (Großfeuerungsanlagenverordnung u.a.) rückläufig. Allerdings überschreiten auch die verringerten Werte die Schwellenwerte für die Verträglichkeit von Waldökosystemen noch beträchtlich. Dabei gilt, daß, wenn Vegetation und Waldökosysteme nicht zu beeinträchtigen sind, 5 kg Schwefel pro Hektar und Jahr nicht überschritten werden sollten.
Stickstoffdeposition: Die Gesamtstickstoffdeposition ergibt sich hauptsächlich aus den Einträgen von Nitrat (Verursacher sind vor allem Kraftfahrzeugmotoren und Heizung) und Ammonium (vor allem aus der Landwirtschaft). In den achtziger Jahren wurden in Rheinland-Pfalz durchschnittliche jährliche Depositionsraten für Stickstoff (Ammonium und Nitrat) von 20 bis 40 kg/ha gemessen.
Im Gegensatz zur Schwefeldeposition zeigen die Stickstoffeinträge in den letzten zehn Jahren eine gleichbleibende bis leicht steigende Tendenz. Da die derzeitigen Stickstoffeinträge auf vielen Standorten in Waldgebieten den Stickstoffbedarf der Waldvegetation weit überschreiten, besteht die Gefahr von Nitratausträgen in Grund- und Oberflächengewässer.
Forderung: weitere Verringerung der Schadstoffemissionen; insbesondere der verkehrsbedingten und landwirtschaftlichen Stickstoffemissionen; siehe auch Kapitel Luft.
Zu Luftschadstoffen siehe auch:
2.4 Bodenversauerung
Der Eintrag von Schwefeldioxid bzw. Sulfat (SO4) und Stickstoffverbindungen, die als Säuren oder "Säurebildner" fungieren, führt zu einer erheblichen Säurebelastung, insbesondere der Waldböden. Innerhalb gewisser Grenzen können die Säureeinträge vom Boden abgepuffert werden. Wird die Pufferkapazität jedoch überschritten so führt dies zu fortschreitender Bodenversauerung. Dadurch verringert sich die Fähigkeit der Böden Nährstoffe festzuhalten. Infolge der Zerstörung von Tonmineralien können Aluminium-, Eisen- und Manganionen im Bodenwasser auftreten, die potentiell giftig wirken. Dadurch kann die Wasserqualität (Oberflächenwasser, Quellwasser, Grundwasser) erheblich beeinträchtigt werden.
Ergebnisse der Bodenanalysen im Forstbereich des Kreises Neuwied
Seit 1988 werden durch die Forstdirektion in den Waldregionen des Landkreises Neuwied regelmäßig Bodenanalysen durchgeführt. Gemessen werden u.a. der pH-Wert, der Gehalt der verschiedenen Nährstoffen (Stickstoff, Phosphor, Kalium, Magnesium, Calcium) und Schadstoffen wie Aluminium-, Eisen- und Manganionen. Letztere sind als Schadstoffe anzusehen. Die Ergebnisse der Bodenanalysen (Stand Juli 1994) sind in den Diagrammen A und B dargestellt.
Boden-pH Der Boden-pH ist abhängig von der Art des Ausgangsgesteins, vom Säureeintrag aus trockener und nasser Deposition sowie von der Baumartenbestockung. Auf saurem Ausgangsgestein, wie Schiefer und Grauwacke entwickeln sich natürlicherweise mäßig saure Böden. Lößböden sind dahingegen natürlicherweise alkalisch bis schwach sauer. Unter tief wurzelndem Laubholzwald ist der Versauerungsprozeß gebremst, da Basen aus dem daran reicheren Unterboden gleichsam an die Bodenoberfläche gepumpt werden. Die flachwurzelnden Nadelholzarten wirken dahingegen durch ihren sauren Bestandesabfall (Nadelstreu) bodenversauernd. Der pH-Wert als Maß für die Säurekonzentration ist folgendermaßen zu bewerten:
pH-Wert Bewertung
> 7,0 alkalisch
7,0 - 6,2 schwach sauer
6,2 - 5,0 mittel sauer
5,0 - 4,2 stark sauer
4,2 - 3,8 sehr stark sauer
3,8 - 3,0 äußerst stark sauer
< 3,0 extrem sauer
Diagramm A gibt den pH-Wert für die häufigsten Bodenarten des Landkreises in den verschiedenen Bodenhorizonten an. Hierunter werden horizontal im Boden verlaufende Zonen verstanden. Ihre Aufeinanderfolge stellt das Bodenprofil dar. Dabei bezeichnet Ah den Oberboden, Bv den darunter liegenden verbraunten Boden und Cv das Ausgangsgestein, aus dem der Boden entstand.
Diagramm A, pH-Werte der häufigsten Bodenarten im Landkreis in den verschiedenen
Bodenhorizonten, Quelle: Forstdirektion Koblenz
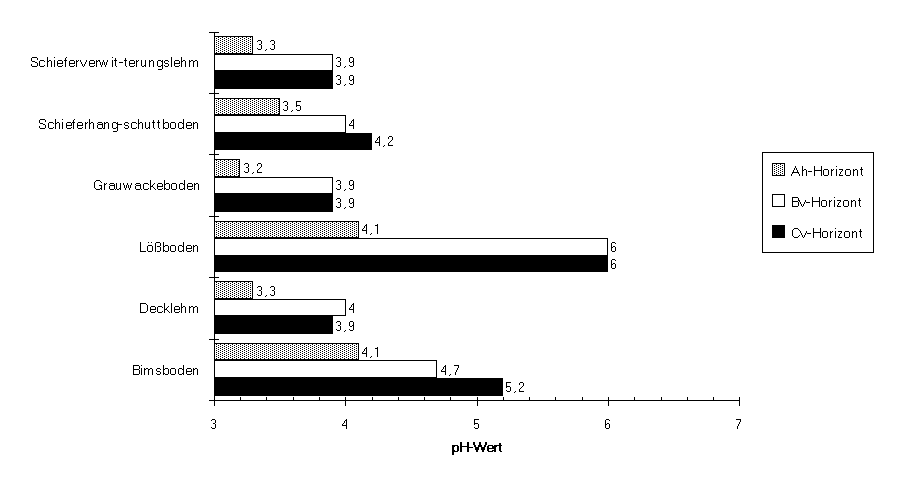
Das Diagramm A zeigt deutlich, daß auf allen Bodenarten im Forst starke Versauerungen im Oberboden (Ah-Horizont) zu verzeichnen sind. Die tiefer liegenden Bodenhorizonte (B-/Cv-Horizont) weisen in allen Fällen höhere pH-Werte (= geringere Säurekonzentration) auf. Für Böden auf saurem Ausgangsgestein, wie Schiefer und Grauwacke, mit einem pH-Wert von etwa 4 im Unterboden werden im Oberboden Mittelwerte von pH 3,5 bzw. pH 3,2 registriert, die als äußerst stark sauer zu bewerten sind. Ebenfalls sehr niedrige pH-Werte weisen mit 3,3 die Decklehme auf, die auch als Lößlehm oder entkalkter Löß bezeichnet werden. Selbst die von Natur aus basischen, kalkhaltigen Lößböden liegen im Oberboden mit einem mittleren pH-Wert von 4,1 im stark sauren Bereich, wohingegen in den darunter liegenden Bodenschichten neutrale bis schwach saure Bodenverhältnisse mit pH 6 im Mittel zu verzeichnen sind.
Aluminium-Ionenkonzentration Bei pH-Werten unter 4 kommt es zur zunehmenden Freisetzung von Aluminium-Ionen aus den Tonmineralien den Bodens. Freie Aluminuim-Ionen wirken giftig auf Pflanzen und Bodenlebewesen. Zudem verursachen sie einen starken Anstieg der Versauerung des Bodens, die Huminbildung im Boden wird verlangsamt, aggressive organische Säuren werden freigesetzt und lösen Schwermetalle, die dann wiederum Schädigungen an den Pflanzen hervorrufen und als sogenannte Mobilanteile ins Grundwasser gelangen können. Je höher die Aluminium-Ionenkonzentration um so höher ist der Mobilanteil im Boden.
Diagramm B, Aluminium-Ionenkonzentration im Oberboden unter aktuell vorliegendem pH-Wert, Quelle: Forstdirektion Koblenz
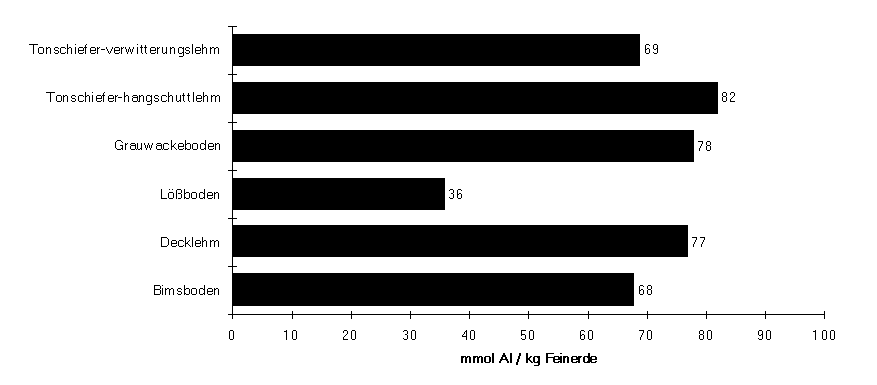
Diagramm B zeigt, daß die Aluminium-Ionenkonzentrationen im Oberboden mit Mittelwerten zwischen 69 und 82 mmol/kg Feinerde in den meisten forstlich genutzten Böden des Landkreises Neuwied im bedenklichen bis stark versauerten Bereich liegt. Eine vollständige Zerstörung der Tonminerale ist jedoch bisher nur punktuell zu verzeichnen. So wurde in Heimbach-Weis auf Bims eine Al-Konzentration im Oberboden von 97,4 gemessen, im Forstamt Dierdorf weist eine Probe den Wert von 110,8 mmol Al/kg auf. In Lößböden beträgt der Mittelwert 36 und liegt somit im unbedenklichen Bereich.
Al-Ionenkonzentration Bewertung
50-70 % bedenklich
70-90 % stark versauert
> 90 % Tonminerale werden zer stört
Bodenschutzkalkung Die gewonnen Daten dienen als Grundlage zur Festsetzung und Kontrolle von Bodenschutzmaßnahmen im Forst. Um der Versauerung entgegenzuwirken werden in den Waldgebieten Kalkungen mit kohlensaurem Magnesiumkalk (3 t/ha) durchgeführt. Die Wirkung hält etwa zehn Jahre an. Die bereits eingesetzte Versauerung des Bodens wird durch die Kalkung jedoch nicht rückgängig gemacht. Es kann nur eine zeitliche Verzögerung der Entwicklung erreicht werden.