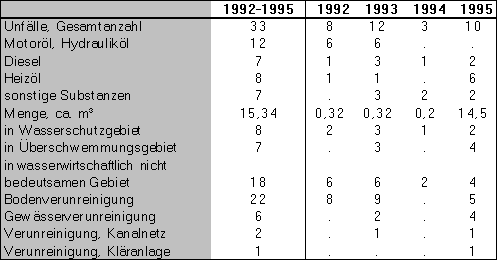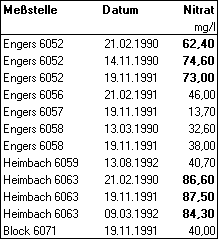
Grundwasserschutz
Die Grundwasserbelastungen haben in der Vergangenheit im Kreis Neuwied kontinuierlich zugenommen. Gefährdungsquellen sind die intensive landwirtschaftliche Bodennutzung, Altlasten, Industrie- und Gewerbebetriebe, Abwasserversickerung, undichte Kanalisation, Emissionen und Unfälle entlang der Verkehrswege sowie Schadstoffeinträge aus der Luft, insbesondere "saurer Regen". Einmal eingetretene Verunreinigungen des Grundwassers bleiben lange bestehen und sind nur schwer oder gar nicht sanierbar.
Im Kreis Neuwied wird das Trinkwasser zu über 90 % aus Grund- und Quellwasser (oberflächennahes Grundwasser) gewonnen. Sauberes Grundwasser ist in seiner Funktion im Wasserhaushalt der Ökosysteme ebenso wie zur Sicherung der Trinkwasserversorgung hinsichtlich Menge und Qualität von existentieller Bedeutung. Deshalb ist ein verstärkter Grundwasserschutz auch aus ökonomischer Sicht dringend erforderlich.
Der Grundwasserschutz wird hauptsächlich über die Sicherstellung einer einwandfreien Trinkwasserversorgung betrieben. Hauptinstrument ist die Ausweisung von Wasserschutzgebieten. Probleme bestehen hierbei in Form von Umsetzungs- und Vollzugsdefiziten. Zahlreiche Schutzgebiete im Kreis sind zu klein ausgewiesen, so daß sie nicht das gesamte Einzugsgebiet umfassen; teilweise werden Wassergewinnungsanlagen ohne Schutzgebiet betrieben. Neueste Erkenntnisse über die Vermeidung von Belastungen durch wassergefährdende Stoffe, Nitrat und Pflanzenschutzmittel sind mit Ausnahme des Wasserschutzgebietes "Engerser Feld" in bestehende Schutzgebietsverordnungen noch nicht eingeflossen. (siehe auch Abschnitt Trinkwasser, Wasserschutzgebiete).
Grundwasservorkommen
Das wichtigste Grundwasservorkommen des Landkreises, befindet sich im Neuwieder Becken. Mit einer Wasserführung von über 10.000 m3/km2 gehört es zu den Grundwassergunstgebieten. Der Grundwasserhaushalt im Neuwieder Becken ist stark von Austauschvorgängen zwischen Grund- und Rheinwasser beeinflußt. Demgegenüber gilt der Westerwald als Grundwassermangelgebiet. Diese ungleiche Verteilung des Grundwassers im Kreisgebiet beruht auf den unterschiedlichen hydrogeologischen Bedingungen. Die grundwasserführenden Gesteine des Neuwieder Beckens, Kiese und Sande, sind Porengrundwasserleiter. Sie zeichnen sich durch ein hohes Wasserdargebot und ihr hohes Filtrationsvermögen hinsichtlich Schadstoffen aus. Außerhalb der Rheinniederungen liegen Schiefer und Grauwacke vor. Hier wird das Grundwasser in Klüften geleitet (Kluftgrundwasserleiter). Das Wasserdargebot ist niedrig, das natürliche Reinigungsvermögen gering.
Grundwasserneubildung
Die Grundwasserneubildung ist abhängig von der Höhe der Jahresniederschläge, ihre zeitlichen Verteilung im Jahr sowie dem Abfluß in die Gewässer. Letzterer wird durch die Bodenverhältnisse bestimmt. Im Winter findet die größte Grundwasserneubildung statt. Niederschläge im Sommer haben aufgrund hoher Verdunstung und Wasseraufnahme durch die Pflanzen einen geringen Einfluß auf die Grundwasserstände. Im Rheintal und im Neuwieder Becken wirken sich zudem die Rheinwasserstände auf den Grundwasserspiegel aus.
Zur Überwachung der Grundwassersituation dienen die vom Landesamt für Wasserwirtschaft betriebenen Grundwasserstandsmeßstellen (22 Meßstellen im Neuwieder Becken) in Verbindung mit Abflußpegeln an Rhein, Wied, Holzbach, Mehrbach und Aubach sowie die Daten der Eigenüberwachung der Trinkwassergewinnungsunternehmen. Die mittlere Grundwasserneubildung in Rheinland-Pfalz beträgt nach Auskunft des Landesamtes für Wasserwirtschft im Bereich der Rheinkiese 3,2 Liter pro Sekunde und km², auf devonischem Schiefer und Grauwacke dagegen nur 1,3 Liter pro Sekunde und km².
Beeinträchtigungen der Grundwasserneubildung
Beeinträchtigungen der Grundwasserneubildung können durch Baumaßnahmen, die zu einem Grundwasserstau bzw. einer Senkung des Grundwasserspiegels führen, erfolgen. Die zunehmende Versiegelung und Bodenverdichtung im Rahmen des Siedlungsbaus, verbunden mit der gängigen Praxis Niederschlagswasser möglichst schnell und vollständig abzuleiten (Mischkanalisation) wirkt sich allgemein negativ auf die Grundwasserbilanz aus. Fast jeder Rohrgraben wirkt als Drainage. Deshalb wird in der Regel ein Drainrohr zusätzlich zum eigentlichen Leitungsrohr eingebaut. Im Grundwasser verlegte Rohrleitungen, zum Beispiel Gaspipelines, können daher eine Absenkung des Grundwassers verursachen. Bodenverdichtung und -erosion führen zu einem verminderten Einsickern von Niederschlagswasser und folglich geringerer Grundwasserneubildung. Zudem kommt es durch die nachlassende Filterkapazität des Bodens zu einem erhöhten, bisher aber kaum quantifizierbaren Stoffaustrag ins Grundwasser und damit zu einer Verschlechterung der Qualität des neugebildeten Grundwassers. Die zur Verbesserung der Agrarstruktur durchgeführten Maßnahmen, insbesondere die Ableitung von Bodenwasser durch Drainagen, tragen ebenfalls zur Verringerung des Grundwasserkörpers bei. Die Reduktion der Grundwassermengen führt möglicherweise zu erheblichen qualitativen Veränderungen im Grundwasserkörper.
Wirksame Maßnahmen zum Schutz der Grundwasserneubildung, wie Förderung der Versickerung und Entsiegelung sind auch im Hinblick auf die Hochwasserbildung, zu treffen und umzusetzen (siehe auch Abschnitt Hochwasserschutz).
Grundwasserbeschaffenheit
Neben den in Abhängigkeit vom jeweiligen Untergrund natürlich in Grundwasser vorkommenden Stoffen finden sich zahlreiche Substanzen im Grundwasser, die auf menschliche Einflüsse zurückzuführen sind. Durch mehr oder weniger dichte Deckschichten wird das Grundwasser gefiltert und ist vor Schadstoffeintrag zunächst besser geschützt als Oberflächengewässer. Ist die Rückhaltekapazität der Deckschicht jedoch erschöpft gelangen Verunreinigungen ins Grundwasser. Eine besondere Gefahr stellen organische Halogenverbindungen (z.B. chlorierte Kohlenwasserstoffe), Mineralöl und seine Produkte, Pflanzenschutzmittel und der Eintrag von Nitrat dar. Der Eintrag von Schadstoffen ins Grundwasser kann entweder großflächig über
durch kleinflächigen direkten Eintrag durch
Grundwasserrelevante Luftschadstoffe sind die säurebildenden Gase Schwefeldioxid (SO2) und Stickoxide (NOx), die bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe entstehen, organische Schadstoffe, wie emittierte Pflanzenschutzmittel oder Lösungsmittel sowie Stickstoffemissionen aus der landwirtschaftlichen Produktion, z.B. Ausdünstung von Ammoniak durch Gülleausbringung (vgl. Kapitel # Luft).
Das Landesamt für Wasserwirtschaft betreibt im Rahmen des Grundwasser-meßnetzes im Kreis Neuwied sieben Grundwasserbeschaffenheitsmeßstellen, die zweimal jährlich beprobt werden. In einer Sonderuntersuchung werden Rohwässer der Trinkwasserversorgung auf Vorkommen von Pflanzenschutzmittel (PSM) analysiert. In die Untersuchungen einbezogen werden auch die Ergebnisse der Eigenüberwachung der Trinkwasserversorgungsunternehmen.
Versauerung
Im Kreisgebiet ist eine fortschreitende Versauerung der Böden (vgl. Bodenuntersuchungen der Forstdirektion, Kapitel Wald, Kapitel Boden) zu verzeichnen. Mit zunehmender Bodenversauerung steigt die Aluminiumkonzentration im Grundwasser an. Aluminium kann somit als Versauerungsindikator angesehen werden. Abbildung # gibt die Aluminiumbelastungen im oberflächennahen Grundwasser im Landkreis Neuwied wieder. Aluminiumwerte zwischen 50 und 200 µg/l (starke Versauerung) wurden in Teilbereichen der Verbandsgemeinde Asbach, Rengsdorf, Puderbach und Dierdorf festgestellt. Werte über 200 µg Al/l (extrem starke Versauerung) treten im Kreisgebiet bisher nur punktuell auf.
Durch Bodenschutzkalkungen kann die Versauerung im Oberboden zeitlich verzögert werden, eine Regeneration des Grundwassers ist hierdurch jedoch nicht erreichbar. Ein effektiver Schutz des Grundwassers vor Versauerung ist bei derzeitigem Stand der Wissenschaft und Technik nur durch weitere drastische Reduzierung der Schadstoffemissionen zu erreichen. Mangelnde Vorsorge verursacht Kosten. So mußten im Bereich Montabaur, im südlichen Hunsrück und im Pfälzer Wald in den vergangenen Jahren aufgrund stark erhöhter Aluminiumkonzentrationen auf tiefer gelegene Grundwasserschichten ausgewichen werden, einige Brunnen wurden geschlossen.
Nitratgehalt im GrundwasserDer natürliche Nitratgehalt des oberflächennahen Grundwassers von 2 - 5 mg/l bzw. bis zu 10 mg/l unter nährstoffreichen Böden (Quelle: Landesamt für Wasserwirtschaft Rheinland-Pfalz 1993) wird heute überall im Kreisgebiet überschritten. Unter besonders exponierten Waldstandorten wird in zunehmenden Maß Stickstoff aus der Luft eingetragen. Wichtigste Ursache der Nitratbelastung des Grundwassers ist jedoch der Düngemitteleinsatz in landwirtschaftlich genutzten Gebieten. Der Nitrataustrag ist besonders hoch beim Ausbringen von Wirtschaftsdüngern (Gülle, Stallmist etc.) oder Komposten und Klärschlämmen auf nicht wachsende Kulturen.
Düngemittelbegrenzungen zum Schutz des Grundwassers erfolgten im Kreisgebiet bislang nur in der Zone I von Trinkwasserschutzgebieten (Düngeverbot im Fassungsbereich) und seit 1991 auch in allen anderen Zonen des Wasserschutzgebietes "Engerser Feld". Ansonsten blieb es den Landwirten überlassen, wann und wieviel Stickstoffdünger ausgebracht wurde. Dabei ist anzumerken, daß die Nitratbelastung in der Regel nicht auf Anwendungsfehler der Landwirte, sondern auf die "ordnungsgemäße" Ausübung der Landwirtschaft zurückgeht. Für die Wasserwirtschaft bedeutet dies, daß außerhalb von Wasserschutzgebieten bisher keine rechtliche Möglichkeit bestand, Vorsorgemaßnahmen zur Verringerung von Stoffeinträgen aus der Landwirtschaft ins Grundwasser durchzusetzen. Seit Anfang 1996 gibt es erstmals eine Düngeverordnung, die bundesweit u.a. eine bedarfsorientierte Düngung vorschreibt und ein generelles Ausbringverbot für Wirtschaftsdünger (Gülle u.a.) in den Wintermonaten enthält. Welche spürbaren Erfolge diese Verordnung mit sich bringt muß sich noch erweisen.
Abbildung # zeigt, daß die höchste Nitratbelastung des Grundwassers im Kreisgebiet mit 50 bis 90 mg/l im Bereich des Neuwieder Beckens (Trinkwasserschutzgebiet "Engerser Feld") zu verzeichnen ist. Laut Grundwasserbericht des Landes 1992 gehört das Neuwieder Becken zu den Regionen mit den höchsten Nitratkonzentrationen in Rheinland-Pfalz. Im sonstigen Kreisgebiet liegen mittlere Nitratgehalte (25 - 50 mg/l) vor, sofern die Böden teils landwirtschaftlich genutzt werden. Unter größeren zusammenhängenden Waldstandorten liegen die Konzentrationen unter 25 mg/l. Auch im Überschwemmungsbereich des Rheins sind erhöhte Nitratwerte auf Düngung zurückzuführen. Die mittlere Konzentration im Rheinwasser beträgt nur rund 15 mg/l.
Die Entwicklung des Nitratgehalts an den Grundwassermeßstellen im Kreis war im Zeitraum 1980 bis 1993 gleichbleibend bis schwach steigend (siehe Tabelle #). Steigende Nitratwerte wurden beispielsweise an der Meßstelle 6052 Neuwied im "Engerser Feld" registriert. Während hier zu Beginn der 80er Jahre noch Nitratwerte um 40 mg/l gemessen wurden lagen die Werte 1992 bei etwa 70 mg/l. Durch strenge Auflagen für die Landwirte wurde dieser Trend im Trinkwasserschutzgebiet "Engerser Feld" gestoppt. Die in 1996 verzeichneten hohen Werte sind nicht unbedingt durch zu hohe Düngemittelmengen sondern durch ungünstige Düngemittelausbringzeiten und die geringen Niederschläge bedingt.
Tabelle #, Nitratgehalte in amtlichen Grundwassermeßstellen, 1990 bis 1992.
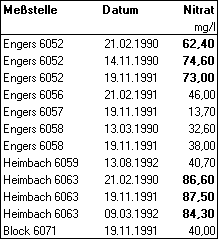
Daten: Grundwasserbericht des Landes 1992;
Hervorhebung = Grenzwertüberschreitung
Tabelle #, Nitratgehalt im Grundwasser der Trinkwassergewinnungsanlagen im WSG "Engerser Feld"
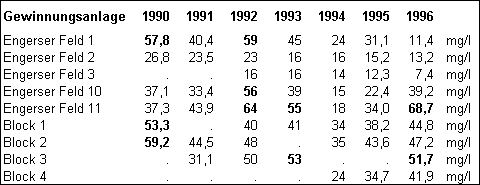
Daten: Kreiswasserwerk Neuwied; Hervorhebung = Grenzwertüberschreitung
Sonderuntersuchung Pflanzenschutzmittel
Die landesweite Sonderuntersuchung wurde nur punktuell in Gebieten mit vorwiegend landwirtschaftlicher Flächennutzung, insbesondere Sonderkulturen (Mais, Obst, Wein), durchgeführt, da hier von einem hohen Einsatz an Pflanzenschutzmitteln (PSM) ausgegangen werden kann. Am häufigsten wurde Atrazin und seine Abbauprodukte sowie das verwandte Simazin nachgewiesen. Obwohl für Atrazin seit 1988 ein Anwendungsverbot für Wasserschutzgebiete und seit 1991 ein generelles Ausbringungsverbot besteht, wird es auch heute noch im Grundwasser in geringen Konzentrationen festgestellt (siehe Tabelle # im Abschnitt Trinkwasser). Ursachen für das Auftreten von Atrazin im Grundwasser können in der langen Verweilzeit der Substanz im Boden, der geringen Abbaurate im Grundwasser oder im weiteren rechtswidrigen Einsatz atrazinhaltiger Pflanzenschutzmittel liegen.
Tabelle # zeigt die Untersuchungsergebnisse bzgl. PSM der amtlichen Grundwassermeßstellen im Stadtbereich Neuwied in den Jahren 1990 bis 1992. Der Grenzwert nach Trinkwasserverordnung beträgt seit 1989 für Einzelstoffe 0,1 µg/l und 0,5 µg/l für ihre Summe. Auch in den Höhenlagen wurden vereinzelt Pflanzenschutzmittel im Grundwasser nachgewiesen.
Die als Herbizide genutzten Triazine Atrazin, Simazin und ihre Abbauprodukte Desisopropyl- und Desethyl-Atrazin. gelangen durch Landwirtschaft und Weinbau oder aus Altlasten ins Grundwasser. Der Brunnen Leutesdorf wurde u.a. wegen einer möglichen Belastung mit Pflanzenschutzmitteln geschlossen, die aus einer Altlast herrührte. Die Substanzen Metolachlor, Metazachlor, Bentazon und Dichlorprop (letztere aus dem Kläranlagenablauf der BASF AG Ludwigshafen) wurden bis etwa 1991 im Rheinwasser nachgewiesen. Sie sind über das Uferfiltrat in die Meßbrunnen gelangt.
Fachleute führen die Herbizideinträge ins Grundwasser in erster Linie nicht auf Anwendungsfehler der Landwirte beim Umgang mit PSM zurück sondern auf die flächenhafte Ausbringung im Rahmen der "ordnungsgemäßen Landwirtschaft". Dieser Begriff ist neu zu definieren. Zur langfristigen Sicherung des Grund- und Trinkwassers ist ein völliger Verzicht auf Pestizide (ökologischer Landbau) unabdingbar. Der Einsatz von Herbiziden auf Gleiskörpern trägt ebenfalls erheblich zum PSM-Eintrag ins Grundwasser bei (vgl. Abschnitt Trinkwasser). Neben Auswaschungen gelangen PSM auch über den Regen aus der Luft in das Grundwasser. Etwa 80 % der Spritzmittel werden beim Ausbringen über die Luft in die Umgebung verfrachtet.
Tabelle #, Pflanzenschutzmittel im Grundwasser im Bereich "Engerser Feld",
Ergebnis der Untersuchungen an amtlichen Grundwassermeßstellen, 1990-1992
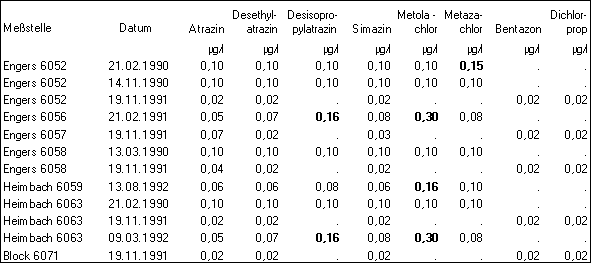
Quelle: Grundwasserbericht 1992, verändert; Wert 0,02 entspricht der Angabe nicht nachweisbar;
hervorgehoben = Überschreitung des Grenzwertes nach Trinkwasserverordnung
Wasserbeschaffenheit unterhalb von Deponien
Die Deponie Fernthal verfügt seit 1991 über eine der modernsten Sickerwasserreinigungsanlagen Deutschlands. Die Reinigung erfolgt mittels biologischer (Belebungsbecken) und chemischer Reinigungsstufe (Ozon, UV-Bestrahlung) sowie durch Adsorbtion (Kohlefilter) und Ionenaustauscher (Entfernung von Schwermetallen). Es können jedoch nicht alle Sickerwässer erfaßt werden, da in den älteren Teilbereichen keine Basisabdichtung vorliegt. Die Wasserbelastung (Sickerwasser, Grundwasser) wird an zehn Meßstellen regelmäßig kontrolliert. Eine Beeinflussung der nahe gelegenen Wassergewinnungsanlage Jungfernhof (Quelle Eilenberg) konnte bisher nicht festgestellt werden.
Die Deponie Linkenbach weist in ihrem neuen Teil eine Basisabdichtung auf. Sickerwässer aus diesem Bereich werden aufgefangen und in der Anlage der Deponie Fernthal behandelt. Die Belastung des Grundwassers mit Sickerwässern aus dem nicht abgedichteten alten Teilbereich ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen und hat sich auf vergleichsweise konstante Werte eingestellt. In den Grundwassermeßstellen weisen die untersuchten Parameter (DOC, AOX, Nitrat, Ammonium, Schwermetalle u.a.) in 1994 zumeist Prüfwerte auf, die laut Merkblatt der Expertengruppe Altlasten des Landesamtes für Umwelt und Gewerbeaufsicht, ALEX 02, der Zielebene zwei zugeordnet werden und somit weder stark ökotoxische Wirkungen noch massive Umweltbeeinträchtigungen verursachen und die üblichen Nutzungen durch den Menschen zulassen. Die in die Untersuchung mit einbezogenen Brunnen Linkenbach, Jahrsfelder Mühle und Oberraden ließen keine Beeinträchtigung durch Deponiesickerwässer erkennen. Der Aubach zeigt dahingegen erhöhte Werte für die Parameter Nährstoffe (Ammonium, Nitrat), gelöste organische Substanzen (DOC), Chlorid und Leitfähigkeit. Die erhöhten Chloridgehalte sind vermutlich nicht auf die Deponie sondern auf den Streusalzeinsatz auf der nahe gelegenen Autobahn zurückzuführen.
Altlasten
In der Vergangenheit wurden ausgebeutete Kiesgruben, die zum Teil bis ins Grundwasser reichen, und andere Bodenvertiefungen (z.B. Siefen) mehr oder weniger unkontrolliert mit Müll verfüllt. Von diesen ehemaligen Müllkippen im Landkreis gehen unkalkulierbare Gefahren für das Grundwasser aus. Zur Erfassung, Beurteilung und Sanierung dieser "Altlasten" siehe Kapitel Boden, Altlasten und Kapitel Wasser, Trinkwasser.
Lagerung und Transport wassergefährdender Stoffe
Durch Unfälle bei Lagerung und Transport aber auch durch Rücksichtslosigkeit von Mitbürgern können Mineralölprodukte und andere wassergefährdende Stoffe in den Boden, in Fließgewässer oder ins Grundwasser gelangen. In den Jahren 1992 bis 1995 wurden bei der unteren Wasserbehörde des Kreises Neuwied dreiunddreißig nach Statistikgesetz meldepflichtige Unfälle bei Lagerung und Transport mit wassergefährdenden Stoffen registriert. Darüber hinaus werden zahlreiche kleinere Unfälle, wie Leckagen an Kraftfahrzeugen gemeldet, bei denen die Gefahr der Bodenverunreinigung durch Mineralöl oder Kraftstoffe besteht.
Wie Tabelle # zeigt, gingen nur wenige Unfälle in den letzten vier Jahren mit einer Gewässerverunreinigung einher. Hierbei handelte es sich in allen Fällen um Hochwasserunfälle, wie beispielsweise nicht ausreichend gesicherte Öltanks. In 22 Fällen wurde Boden durch Mineralöle oder sonstige Stoffe verunreinigt. Durch sofortiges Auskoffern mit anschließendem Deponieren des verunreinigten Bodens wurde weitergehenden Schäden entgegengewirkt.
Sandoz-Kommission
Ausgelöst durch die Brandkatastrophe bei dem Schweizer Pharmakonzern Sandoz wurde aufgrund der Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes 1987 die systematische Erfassung aller Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und öffentlicher Einrichtungen begonnen (Sandoz-Kommission). Im Kreisgebiet wurden bisher etwa 55 Betriebe überprüft. Die Untersuchungen wurden vorrangig im Wasserschutzgebiet "Engerser Feld" durchgeführt sowie bei den aus Sicht des Gewässerschutzes problematischen Betrieben im Kreisgebiet, wie beispielsweise Chemiebetriebe, Betriebe zur Papierfabrikation und Verzinkereien. Eine Ausdehnung der Überprüfungen auf alle mit wassergefährdenden Stoffen umgehenden Betriebe und die wiederholte Prüfung der besonders problematischen Betriebe ist erforderlich.
Tabelle: #, nach Statistikgesetz meldepflichtige Unfälle bei Lagerung und Transport wassergefährdender Stoffe, 1992-1995