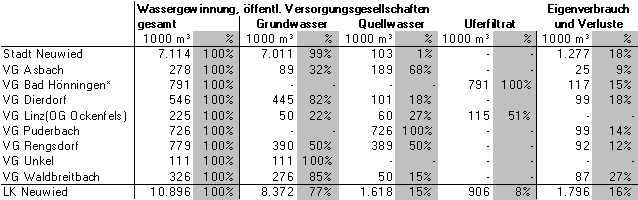
Wasserversorgung
Die Wasserversorgung im Kreis Neuwied erfolgt entweder über kommunale Wasserwerke oder durch private Wasserverbände. Von den öffentlichen Wasserwerken werden in ca. 80 Wassergewinnungsanlagen jährlich etwa 11.000.000 m³ Trinkwasser gewonnen. Größtes Versorgungsunternehmen ist das Kreiswasserwerk in Neuwied. Außer dem Stadtbereich Neuwied beliefert es die Verbandsgemeinden Linz (mit Ausnahme der Ortsgemeinde Ockenfels), zu 90 % die Verbandsgemeinde Asbach und seit 1995 auch die Verbandsgemeinde Bad Hönningen mit Trinkwasser. in der Verbandsgemeinde Asbach. Die Verbandsgemeinden Dierdorf, Puderbach, Rengsdorf und Waldbreitbach betreiben eigene Wassergewinnungsanlagen. Die Verbandsgemeinde Unkel besitzt seit 1992 keine eigene Wasserversorgung mehr sondern wird von der Bad Honnef AG mit Wasser beliefert. Die Karte "Wasserversorgung" (Seite #) gibt eine Übersicht über die wichtigsten Wassergewinnungsanlagen und Hauptleitungen im Kreis. Aufgrund des gewählten Maßstabs wurden Quellen und kleinere Versorgungseinrichtungen der privaten Verbände nicht in die Karte mit aufgenommen. Der Anteil der Einzelversorger beträgt etwa 1000 Personen (0,6 % der Einwohner).
Tabelle #, Wassergewinnung durch öffentliche Versorgungsunternehmen, gegliedert nach Verbandsgemeinden
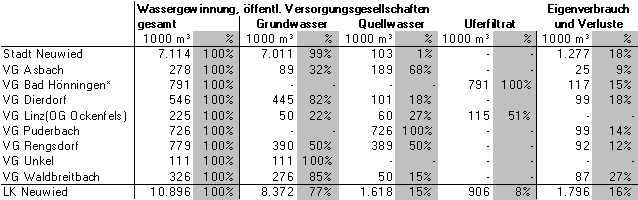
Quelle: Statistisches Landesamt 1991, verändert
* ab 1995 Versorgung durch Kreiswasserwerk
Die Wassergewinnung im Landkreis erfolgt zu 77 % aus Grundwasserbrunnen, Quellwasser macht 15 % und Uferfiltrat 8 % der Wassergewinnung aus. Tabelle # gibt die Daten bezogen auf die einzelnen Verbandsgemeinden an. Die Verbandsgemeinde Asbach, Puderbach und Rengsdorf decken 50 bis 100 % ihres Trinkwasserbedarfs aus Quellen. Das Wasser in der Verbandsgemeinde Linz wird zu 51 % aus Rheinuferfiltrat gewonnen. Die Verbandsgemeinde Bad Hönningen betreibt seit Anfang 1995 keine eigene Wassergewinnung mehr und wird mit Grundwasser durch das Kreiswasserwerk versorgt. In den anderen Verbandsgemeinden und der Stadt Neuwied wird ebenfalls überwiegend Grundwasser über das Kreiswasserwerk bzw. die Stadtwerke Neuwied in das Trinkwassernetz eingespeist.
Die meisten Rheinorte besitzen heute keine eigenen Wassergewinnungsanlagen mehr. Ursache für die Schließungen sind meist die Beeinträchtigungen durch Bebauung im Wasserschutzgebiet und durch Altlasten. Die Ausweisung von Gewerbegebieten in ehemaligen Wasserschutzgebieten ist beispielsweise in den Verbandsgemeinden Dierdorf (OG Dernbach) und Unkel geplant bzw. umgesetzt worden. Diese Vorgehensweise muß aus Sicht der Trinkwasserversorgung der Bevölkerung als kurzsichtig bezeichnet werden. Vorhandene Wassergewinnungsanlagen sollten nach Aufgabe der Nutzung als Notbrunnen erhalten und dementsprechend geschützt werden.
Wasserverbrauch / Wassereinsparung
Das größte Wassersparpotential ist dort zu erwarten, wo der größte Verbrauch stattfindet. Dies sind nach Tabelle # mit etwa 90 % des Wasserverbrauchs Haushalte und kleingewerbliche Betriebe in Wohngebieten, die statistisch nicht von den Haushalten zu trennen sind. Pro versorgtem Einwohner und Tag betrug der Trinkwasserverbrauch 1991 im Bereich Haushalte und Kleingewerbe im Landkreis Neuwied im Mittel 135,4 Liter. Er lag damit knapp über dem Durchschnittsverbrauch im Regierungsbezirk Koblenz (133,6 Liter) und unter dem Landesdurchschnitt von 138,3 Liter. Gegenüber einem Pro-Kopf-Verbrauch von 151,1 Liter in 1987 hat sich der Verbrauch durch Einsatz wassersparender Geräte (z.B. Waschmaschine, Spülmaschine) und Armaturen bisher um 12,8 Liter verringert.
Weitere Wassereinsparmöglichkeiten im Haushaltsbereich sind durch die Ausweitung des Einsatzes technischer Maßnahmen verbunden mit einer Änderung des Verbraucherverhaltens hin zu einer rationellen Wasserverwendung gegeben. Vor allem im Bereich der Körperhygiene (Duschen, Baden) und bei der Toilettenspülung bestehen weitergehende Einsparmöglichkeiten. So sind längst nicht alle Haushalt mit wassersparender Technik ausgerüstet. Im Schnitt rauschen beispielsweise in Rheinland-Pfalz täglich 45 Liter Trinkwasser pro Person durch das WC; mit einer WC-Spartaste läßt sich der Wasserverbrauch pro Spülung von 9 bis 14 Liter auf 3 reduzieren. Für Baden und Duschen werden 42 Liter benötigt. Dies entspricht, wie in Abbildung # dargestellt, über 60 % des gesamten Wasserverbrauchs im Haushalt. Nur 2 % (ca. 3 Liter) werden täglich zum Trinken und zur Nahrungszubereitung genutzt.
Abbildung #, Wasserverwendung in Haushalten
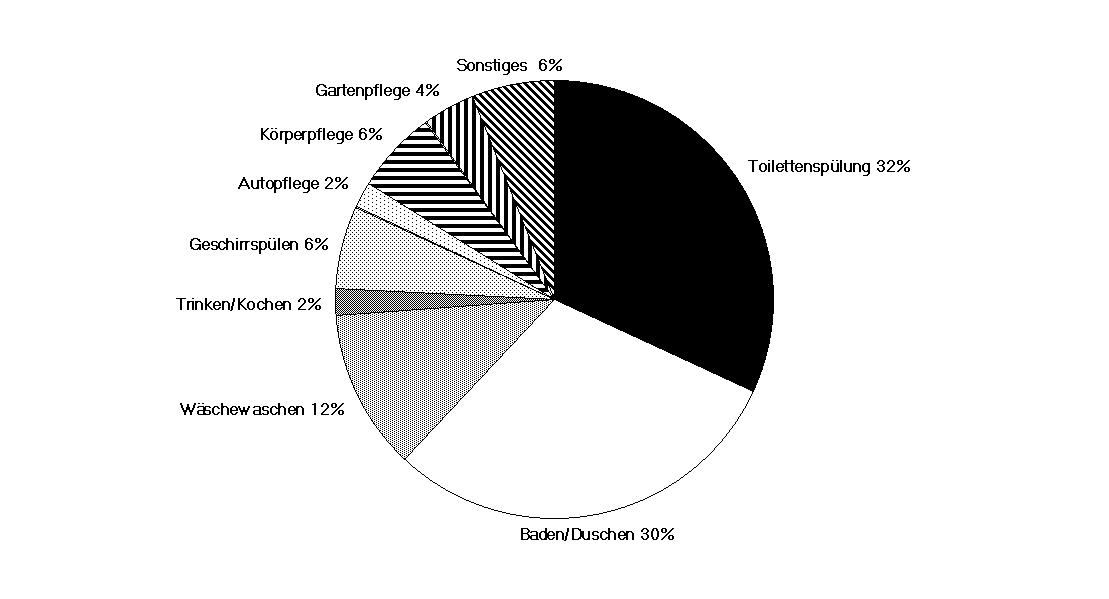
Quelle: Landesarbeitsgemeinschaft Wasser
Der Trinkwasserverbrauch für Industrie und Großgewerbe aus dem öffentlichen Netz lag 1991 mit 6,5 % des Gesamtverbrauchs und 842.000 m³ absolut und relativ nur geringfügig höher als 1987
(7,5 % entsprechend 716.000 m³/Jahr). Eine etwa gleich große Menge Wasser mit Trinkwasserqualität wird in betriebseigenen Brunnen gewonnen. Das gesamte Wasseraufkommen (Trinkwasser plus Brauchwasser) der größeren Unternehmen (Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten) belief sich 1991 auf knapp 13 Millionen Kubikmeter Wasser. Darunter etwa 5,4 Millionen Kubikmeter aus Uferfiltrat, Grund- und Quellwasser. Oberflächenwasser machte knapp 60 % des Wasseraufkommens aus. Einsparpotentiale im industriellen Bereich bestehen durch moderne Technologien mit Mehrfachnutzung bzw. Kreislaufsystem. Diese Technologie wurde in 1991 von 34 Betrieben der 151 ansässigen Betriebe im Kreis Neuwied angewandt.Der Trinkwasserverbrauch durch sonstige Abnehmer wie z.B. Krankenhäuser, landwirtschaftliche Betriebe oder für öffentliche Zwecke (Schulen, Bäder, Feuerwehr etc.) ist in den letzten Jahren vor allem durch Zunahme öffentlicher Einrichtungen steigend. Mit 4,4 % macht er jedoch nur einen Bruchteil des Wasserverbrauchs aus. Für diesen Bereich gelten die gleichen Wassereinsparmöglichkeiten wie für den Bereich Haushalte und Kleingewerbe.
Tabelle #, Entwicklung des jährlichen Trinkwasserverbrauchs (öffentliche Wasserversorgung) von 1983 - 1991 im Kreis Neuwied,
Wasserverbrauch absolut: |
1983 |
1987 |
1991 |
|||||
| Haushalte und Kleingewerbe | 1000 m³ | 8.211 |
89,6 % |
8.572 |
89,1 % |
8.177 |
86,7 % |
|
| Gewerbliche Unternehmen | 1000 m³ | 784 |
8,6 % |
716 |
7,4 % |
842 |
8,9 % |
|
| sonstige Abnehmer | 1000 m³ | 167 |
1,8 % |
332 |
3,5 % |
417 |
4,4 % |
|
| Abgabe insgesamt | 1000 m³ | 9.162 |
100 % |
9.620 |
100 % |
9.436 |
100 % |
|
| Eigenverbrauch und Wasserverluste |
1000 m³ | - |
- |
- |
- |
1.796 |
16 % |
|
Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, verändert
Tabelle #, Trinkwasserverbrauch pro Einwohner, 1983 bis 1991.
Wasserverbrauch pro Einwohner und Tag: |
1983 |
1987 |
1991 |
|||||
| Haushalte und Kleingewerbe | Liter | 145,7 |
151,1 |
135,4 |
||||
| Gewerbliche Unternehmen | Liter | 13,9 |
12,6 |
13,9 |
||||
| sonstige Abnehmer | Liter | 3,0 |
5,9 |
6,9 |
||||
| Abgabe insgesamt | Liter | 162,6 |
169,6 |
156,2 |
||||
| Eigenverbrauch und Wasserverluste |
Liter | - |
- |
29,7 |
- |
|||
Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, verändert
Der Wasserwerkseigenverbrauch und durch Undichtigkeiten im Leitungsnetz verursachte Wasserverluste sind ebenfalls steigend. In 1991 liegen die Verluste im Kreisgebiet mit bis zu 27 % der Wasserförderung (Verbandsgemeinde Waldbreitbach) und 16 % im Mittel über dem Landesdurchschnitt von 10 % (siehe Tabelle #). Zur Reduktion der Wasserverluste ist eine Überprüfung der Wasserleitungen und Sanierung der undichten Abschnitte erforderlich.
Neben den genannten Wassereinsparmöglichkeiten kann eine Verringerung des Wasserverbrauch durch den Ersatz von Trinkwasser durch Brauchwasser für Zwecke, die keine Trinkwasserqualität erfordern, erreicht werden. Im öffentlichen Bereich könnte Brauchwasser z.B. zur Grünflächenbewässerung, zur Kanalspülung und als Baustellenwasser eingesetzt werden. Die Brauchwassernutzung im Haushaltsbereich, beispielsweise zur Gartenbewässerung oder Toilettenspülung, ist aus hygienischen Gründen jedoch umstritten. Hier ist sicherzustellen, daß kein Brauchwasser durch Fehlanschlüße in die Trinkwasserleitung eingespeist wird.
Trinkwasserqualität
Die Wasserqualität des durch das Kreiswasserwerk und die Stadtwerke Neuwied bezogenen Trinkwassers aus dem "Engerser Feld" ist als außerordentlich gut zu bezeichnen. Eine Aufbereitung des Wassers ist nicht erforderlich. Lediglich zur Transportdesinfektion werden falls erforderlich in den Sommermonaten geringe Mengen Chlor zugesetzt. Eine Wasseranalyse entsprechend der Trinkwasserverordnung wird jährlich in der Presse veröffentlicht.
Bestimmungen über die Beschaffenheit des Trinkwassers und Grenzwerte für gesundheitsschädliche Stoffe sind in der auf Grundlage des Bundesseuchengesetzes und des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes erlassenen Trinkwasserverordnung enthalten. Die Überwachung obliegt dem Gesundheitsamt und der Lebensmittelüberwachung.
Nitratgehalt
Erhöhte Nitratkonzentrationen im Trinkwasser sind für den Menschen gesundheitsgefährdend. Das aus Nitrat durch Umwandlung entstehende Nitrit kann bei Säuglingen Blausucht auslösen, im Verdauungstrakt des Menschen kann es zur Bildung krebsauslösender Nitrosamine kommen. Daher wurde im Rahmen der Novellierung der Trinkwasserverordnung von 1986 der bis dahin gültige Grenzwert von 90 mg/l auf 50 mg/l herabgesetzt. Der von der EG empfohlene Richtwert liegt bei 25 mg/l.
Das im Kreis eingespeiste Trinkwasser wies 1991 zu etwa 70 % einen Gehalt 25 bis 50 mg Nitrat/l auf und liegt somit unter dem Grenzwert der Trinkwasserverordung, jedoch über dem EG-Richtwert. Die höchsten Nitratbelastungen mit Werten von z.T. über 50 mg/l in einzelnen Brunnen fanden sich, bedingt durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung, im "Engerser Feld" und, bedingt durch den Weinbau, im Rheintal (Verbandsgemeinden Bad Hönningen und Unkel). In den mehr forstwirtschaftlich genutzten Höhengebieten ist der Nitratgehalt mit Werten unter 25 mg/l in der Regel deutlich niedriger. Zur Begrenzung des Nitrateintrags in das Grundwasser bzw. Trinkwasser wurde in die neue Verordnung für das Wasserschutzgebiet "Engerser Feld" Düngebegrenzungen aufgenommen. Hierdurch wurde ein weiterer Anstieg der Nitratbelastung gestoppt. Tabelle # gibt den Nitratgehalt in den Brunnen des WSG "Engerser Feld" von 1990 bis 1996 an. Die in 1996 verzeichneten hohen Werte sind nicht unbedingt durch zu hohe Düngemittelmengen sondern durch ungünstige Düngemittelausbringzeiten und die geringen Niederschläge bedingt.
Tabelle #, Nitratgehalt im Wasser der Gewinnungsanlagen im WSG "Engerser Feld"
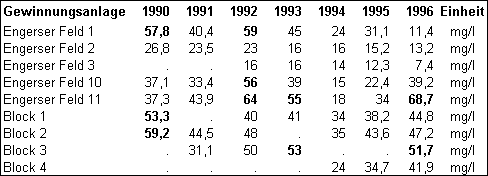
Daten: Kreiswasserwerk; Hervorhebung = Grenzwertüberschreitung
Zur Einhaltung des Nitratgrenzwertes von 50 mg/l Trinkwasser wird belastetes Grundwasser vor der Abgabe ins Netz mit unbelastetem gemischt. In Tabelle # ist der Nitratgehalt des vom Kreiswasserwerk in das Trinkwassernetz eingespeisten Wassers im Hochbehälter Melsbach aufgeführt.
Tabelle #, Nitratgehalt im Trinkwasser des Kreiswasserwerkes, Hochbehälter Melsbach
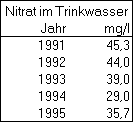
Die meisten direkt am Rhein gelegenen Wassergewinnungsanlagen mußten aufgrund erhöhter Nitratbelastungen durch Einträge aus dem Weinbau in den letzten Jahren geschlossen werden. Beispielsweise konnte der Brunnen Leutesdorf (Verbandsgemeinde Bad Hönningen) aufgrund erhöhter Nitratwerte für eine Übergangszeit nur mit Sondergenehmigung zur Trinkwassergewinnung genutzt werden; seit Anfang 1995 erfolgt die Wasserversorgung für die gesamte Verbandsgemeinde Bad Hönningen durch das Kreiswasserwerk.
Bezogen auf die einzelnen Gewinnunganlagen ergab sich für 1991 folgende Bilanz: in 15 Anlagen im Kreisgebiet wurden Werte über 25 mg Nitrat/l Rohwasser registriert, in zwei Fällen lagen die Werte über dem Grenzwert von 50 mg/l (Brunnen im "Engerser Feld", Brunnen Leutesdorf). In nur acht Anlagen wurden Werte von weniger als 10 mg Nitrat/l im Rohwasser verzeichnet.
Bei Eigenwasserversorgungsanlagen treten besteht im allgemeinen eine höhere Nitratbelastung als bei Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung. Dies liegt vor allem daran, daß die Wasserentnahme oberflächennah erfolgt und keine Schutzgebiete besitzen.
Pflanzenschutzmittel
Pflanzenschutzmittelbelastungen im Grundwasser sind im wesentlichen durch Wirkstoffe gegen die Begleitflora (Herbizide) und gegen bodenlebende Fadenwürmer (Nematizide) verursacht. Als unerwünschte anthropogene Verunreinigung besteht für Pflanzenschutzmittel und ihre Abbauprodukte ein Vorsorgegrenzwert nahe der heute technisch möglichen Nachweisgrenze von 0,1 µg/l für Einzelstoffe und 0,5 µg/l für die Summe aller Substanzen.
Im Kreisgebiet wurden 1991 an vier von dreiunddreißig untersuchten Trinkwassereinspeisungsstellen Pflanzenschutzmittel (PSM) als Wasserinhaltsstoffe in geringen Konzentrationen festgestellt. Aus den Analysedaten der Trinkwasserbrunnen im "Engerser Feld" (Angaben durch das Kreiswasserwerk) geht hervor, daß beispielsweise das schwer abbaubare, in der BRD in Wasserschutzgebieten seit 1988 verbotene Pflanzenschutzmittel Atrazin in geringen Konzentrationen im Trinkwasser vorkommt (vgl. Tabelle #, Abschnitt Grundwasser). Des weiteren wurde vereinzelt Desethyl-Atrazin, Simazin und Bromacil (1992) nachgewiesen. Im heute geschlossenen Brunnen Leutesdorf traten vor einigen Jahren Pflanzenschutzmittel im Rohwasser aus einer nahegelegenen Müllkippe (Altlast) auf.
Tabelle #, Atrazingehalt im Wasser der Wassergewinnungsanlagen im WSG "Engerser Feld"
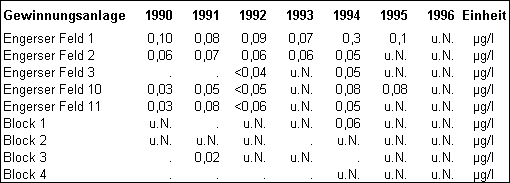
u.N. = unterhalb der Nachweisgrenze
Säuregrad, pH-Wert
Probleme bezüglich der Trinkwasserqualität bereitet landesweit die zunehmende Versauerung des Grundwassers in den Höhengebieten, die mit der Versauerung der Böden insbesondere auf Waldstandorten einhergeht. (siehe auch Kapitel Wald und Kapitel Boden). Das saure, weiche Wasser kann durch seinen Gehalt an freier Kohlensäure in den Leitungen zu Korrosion führen. Je nach Leitungsmaterial könnten dann Kupfer, bei älteren Hausleitungen Blei, in Lösung gehen. Der Grenzwert für den Säuregrad des Trinkwassers beträgt laut Trinkwasserverordnung pH 6,5 - 9,5. Zur Einhaltung des Grenzwertes kann das Wasser durch Gasaustausch oder durch Einsatz basischer Stoffe und nachfolgende Filtration aufbereitet (neutralisiert) werden. Im Kreisgebiet sind die pH-Werte des Trinkwassers relativ stabil. Über 80 % des Trinkwassers weist Werte im pH-Bereich 6,5 bis 7,5 (neutrale Reaktion) auf. 13 % des Trinkwassers zeigt eine schwach basische Reaktion (pH 7,5 bis 9,5). Nur im Westerwaldbereich liegt an einzelnen Gewinnungsanlagen saures Rohwasser mit Werten unter pH 6,5 vor.
Eisen-, Mangangehalt
Im Westerwaldbereich liegen geogen bedingt bei fast allen Brunnen erhöhte Eisen- und Manganwerte im Rohwasser vor. Zur Einhaltung der Grenzwerte (Mangan 0,05 mg/l, Eisen 0,2 mg/l) wird das Wasser durch Oxidation bzw. katalytische Filtration aufbereitet. Im Bereich des "Engerser Feldes" treten keine Belastungen des Rohwassers mit Eisen oder Mangan auf.
Bakterielle Verunreinigungen
Über die Wasserschutzgebietsausweisung ist die Gefahr der mikrobiellen Verunreinigung im Rohwasser der öffentlichen Gewinnungsanlagen weitgehend unterbunden. Die 50-Tage-Passage (Schutzzone II) führt zum Absterben bzw. Inaktivieren der Mikroorganismen. Grundsätzlich ist die Gefahr bakterieller Verunreinigung bei Nutzung von oberflächennahem Grundwasser (Quellen) höher als bei Nutzung von tief liegendem Grundwasser (Brunnen).
Im Bereich der Brunnen des "Engerser Feldes" lagen bisher keine bakteriologische Beeinträchtigungen vor. Die Kies- und Sandablagerungen des Rheins haben aufgrund ihres großen Filtrationsvermögens eine gute Reinigungswirkung. Eine Aufbereitung des Wassers ist daher nicht erforderlich. Lediglich im Sommer werden bei Bedarf geringe Mengen Chlor zur Transportdesinfektion zugesetzt.
Beanstandungen traten im Kreisgebiet vereinzelt bei Selbstversorgern auf. Eigengewinngsanlagen besitzen kein Schutzgebiet, die Wasserentnahme erfolgt meist oberflächennah. Bakteriologische Belastungen können dann durch die Versickerung von Abwasser aus undichten Fäkalgruben, defekten Abwasserleitungen, unter Misthaufen oder durch die Ausbringen von Gülle im Einzugsbereich der Wassergewinnungsanlage hervorgerufen werden.